Sicherheit soll zum Wahlkampfthema von Bundeskanzler Olaf Scholz werden. Datenschutz muss sich deshalb im Wahlprogramm seiner SPD hintenanstellen. Und nicht nur dort, auch die anderen Parteien wollen lieber Bürokratie abbauen. Gegen Desinformation wollen dagegen fast alle irgendetwas tun, nur Zensur natürlich nicht. Unsere Science-Fiction- und Cybersicherheits-versierte Kolumnistin @Kryptomania alias Aleksandra Sowa war nach der Analyse der Wahlprogramme durchaus beunruhigt.
Eine Kolumne von Dr. Aleksandra Sowa
„Es ist Sonntag früh,
da hört noch keiner so richtig zu,
was man sagt.“
Mit diesem heiteren Dreizeiler, der dem Haiku-Stil nachempfunden ist, begann am Sonntag, dem 5. Januar 2025, die Präsentation der Wahlkampagne der SPD. Mit 10 Uhr eine ungewohnt frühe Uhrzeit, wie das vermeintliche Haiku, das übrigens nicht vom SPD-Generalsekretär Matthias Miersch, der zum Treffen einlud, sondern von einem (anonymen) Tontester stammte, humorvoll anklingen ließ. Und doch gerade noch rechtzeitig, um in die Zeitlücke zwischen Neujahr und dem traditionellen Dreikönigstreffen der FDP zu passen.
Matthias Miersch präsentierte allen, die es an diesem ersten Sonntag des Jahres ins eher asketisch anmutende Willy-Brandt-Haus geschafft oder sich per Livestream auf YouTube zugeschaltet hatten, drei zentrale Plakatmotive der SPD: „Mit Sicherheit mehr Wachstum“, „Mit Sicherheit stabile Renten“ und „Mit Sicherheit mehr Netto“. Drei Motive – ein Gesicht: das des Bundeskanzlers Olaf Scholz, der in einer an den „Big Brother“ aus 1984 anmutenden Ästhetik von allen drei Plakaten herabblickt. Oder wie im gleichnamigen Macintosh-Werbespot, der während des Super Bowls 1984 ausgestrahlt wurde: „We shall obey!“, sagt das Gesicht auf dem riesigen Bildschirm in der Werbung, bevor eine Hammerwerferin – dicht verfolgt von der Gedankenpolizei – den Bildschirm mit einem gekonnten Wurf zerschmettert. An diesem Sonntagmorgen wurde jedoch nichts zerschmettert oder beworfen. Es wurden lediglich höflich (sehr wenige) Fragen gestellt.
In seinem Spot erklärte Apple, warum das Jahr 1984 nicht wie George Orwells 1984 sein würde: Mit der Einführung von Personal Computern, die den Anspruch hatten, nicht weniger als eine Art „Volkscomputer“ zu werden, sollten die Bürgerinnen und Bürger sich künftig kein X für ein U vormachen lassen. Eine neue Ära des unzensierten Zugangs zu Information und Kommunikation zu mehr oder weniger erschwinglichen Preisen würde beginnen.
Was die Kampagnenpräsentation der SPD mit 1984 zu tun hat? Neben der an Big Brother erinnernden Optik der Plakate fällt bei Analyse der Wahlprogramme zur Bundestagswahl auf, dass die Parteien zwar keine Zensur wie im Roman planen, aber eine völlig ungezügelte digitale Öffentlichkeit doch kritisch sehen – die Stichworte: „Desinformation“, „Hass“, „Hetze“. Und der vor Überwachung schützende Datenschutz, muss hinter der Sicherheit, die übrigens das zentrale Versprechen von Big Brother an seine unterdrückte Bevölkerung war, zurückstecken – zumal in Zeiten des Bürokratieabbaus. Aber der Reihe nach.
Pünktlich zum Wahlkampf: Rückkehr zu X nach beleidigten Abgängen
Das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP in der bourgeoisen Kulisse des Stuttgarter Opernhauses, beworben mit dem feschen Hashtag #3k25, wurde im Livestream auf YouTube übertragen und durch eine kleine Kampagne im Internet begleitet. Denn, Kritik an den Tech-Plattformen hin oder her: Auf soziale Medien wollen deutsche Parteien und Politiker in diesem Wahlkampf nicht verzichten – auch jene nicht, die sich zuvor beleidigt von Twitter zurückgezogen haben. Nach dem Dreikönigstreffen und dem Sonntag in der SPD-Parteizentrale bleiben den Parteien nur sieben Wochen bis zu den Wahlen. Und das ist wahrlich nicht viel.
Praktisch unmittelbar nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den US-Präsidentschaftswahlen, der zeitlich mit dem Bruch der Ampel-Koalition zusammenfiel, kehrte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zu seinem X-Account @roberthabeck zurück: „[f]ast sechs Jahre nach seinem Abschied von Twitter“ und diesmal „Back for good“, wie er mitteilte. Nur wenige Tage später tauchte überraschend auch der SPD-Parteivorstand unter @spdde auf X mit dem Motto auf: „Damit euch hier kein X für ein U vorgemacht wird: Die SPD ist zurück.“
Bereits am 11. November (wichtiges Datum in Köln!) verriet Robert Habeck in einer X-Bildbotschaft, was ihn antreibt: „[…] dass wir uns nicht anschreien, sondern miteinander reden, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind.“ Kurz darauf, am 13. November, übermittelte der SPD-Parteivorstand via X eine Botschaft von Olaf Scholz: „[…] Ich möchte, dass wir nicht nur übereinander reden, sondern auch miteinander. Ich möchte, dass wir nicht auf andere herabschauen.“ Ein Gesprächsangebot also – keine hektische Rückkehr zu einer unbeliebten und regulierungsresistenten Plattform, die nun in dem Ruf steht, hinter dem Wahlerfolg von Donald Trump zu stehen und die zuvor zahlreiche deutsche Politikerinnen, Politiker und Parteien wegen „Hass und Hetze“ beleidigt verlassen haben?
Vor der #BTW25 waren manche der X-Rückkehrer ganz anders bei Social Media aktiv. Etwa mit Strafanzeigen gegen Follower, die Hassnachrichten oder Beleidigungen verbreiten. Im Sommer 2024 teilten das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sowie das Abgeordnetenbüro von Robert Habeck mit, seit April 2023 mehr als 700 Anzeigen erstattet zu haben: „Es geht um Hassnachrichten an den Bundeswirtschaftsminister.“
Gegen Desinformation: Keine „staatliche Zensur“, sondern „wirksame Moderation“
Der Kampf gegen Hass im Netz, Fake News oder Desinformation – sei es im Rahmen nationaler Resilienz, hybrider Kriegsvorsorge oder Jugendschutz – ist tatsächlich ein wichtiges Thema der Wahlprogramme fast aller größeren Parteien in diesem Wahlkampf. So möchte die SPD „Regelungen gegen Hasskriminalität und andere Straftaten im Netz sowie zum Jugendschutz“ in ihrem Regierungsprogramm Mehr für Dich. Besser für Deutschland umsetzen: „Plattformbetreiber werden verpflichtet, illegale Inhalte zu entfernen, während wir gleichzeitig den Jugendschutz stärken, etwa durch effektive Möglichkeiten zur Altersverifikation.“ Desinformation als Mittel der (hybriden) Kriegsführung – und darüber hinaus – will die SPD durch Maßnahmen wie historische Bildung, Medienkompetenz, Bot-Kennzeichnungspflicht oder Zivilverteidigung bekämpfen: „Im Kampf gegen Desinformation muss staatliche Aufsicht sich zurückhalten, um kein Gefühl von staatlicher Zensur aufkommen zu lassen. Aber der Staat kann wirksame Moderation von Plattformen einfordern, unabhängige Medien fördern, die unter anderem auch Faktenchecks durchführen, die Zusammenarbeit und den Ausbau mit Berufsverbänden und Gremien der Selbstregulierung, beispielsweise dem Presserat, stärken“.
CDU/CSU sehen Desinformation in ihrem Wahlprogramm Politikwechsel für Deutschland als einen Aspekt der Netzsicherheit und versprechen: „Wir stellen sicher, dass bei der Umsetzung des Digital Services Act der Schwerpunkt auf mehr Transparenz, Kampf gegen Desinformation sowie Jugend- und Medienschutz gelegt wird“.
Bündnis 90/Die Grünen greifen in ihrem Regierungsprogramm 2025 Zusammen wachsen die Desinformation ebenfalls als Aspekt der IT-Sicherheit auf. Neben Medienbildung und der Verpflichtung von Plattformen wollen sie „die systematische Verbreitung von Desinformation im Auftrag eines fremden Staates […] strafrechtlich fassen“. Ziel sei es, „die systematische Desinformation und organisierte Kriminalität sowie das grenzenlose Ausweiten von Hass und Hetze durch Bots [und] anonymisierte Accounts, die derzeit strafrechtlich kaum verfolgt werden können“, anzugehen. Dazu sollen „die effektiven Möglichkeiten der deutschen Strafverfolgungsbehörden im digitalen Raum“ verbessert werden.
Der Staat selbst darf die Cybersicherheit nicht durch den Einsatz von Staatstrojanern gefährden. (FDP)
Die FDP betrachtet Desinformation als eine hybride Angriffsart autoritärer Staaten und möchte dieser mit Mitteln der Cybersicherheit entgegentreten: „Wir […] wollen, dass unser Land die hybriden Angriffe autoritärer Staaten, wie etwa Russland und China, endlich ernst nimmt. Sie wollen mit Angriffen wie Spionage, Sabotage, Desinformation und Cyberangriffen unsere Demokratie systematisch unterwandern.“ Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören proaktive Informationen über Angriffe, ein geordnetes Schwachstellenmanagement sowie die Neuordnung staatlicher Zuständigkeiten. Darüber hinaus fordert die FDP das Prinzip Security by Design, die Einführung einer Anbieterhaftung für Schäden durch Sicherheitslücken, den Ausbau von Rechenzentren und die Stärkung fachlicher Kompetenzen. „Der Staat selbst darf die Cybersicherheit nicht durch den Einsatz von Staatstrojanern gefährden“, so die FDP. Netzsperren, Chatkontrollen, Uploadfilter, Vorratsdatenspeicherung „und andere Formen der anlasslosen Datenerfassung“ lehnen die Freien Demokraten ab.
Hierbei, allerdings mehr auf der Ebene der Maßnahmen als der Ziele, zeigen sich überraschend einige Parallelen zum Wahlprogramm von Die Linke Du verdienst mehr. Die Partei möchte „Digitalisierung fürs Gemeinwohl – statt für Konzernprofite“ mit unter anderem diesen Maßnahmen erreichen: IT-Sicherheitsforschung entkriminalisieren, „Sicherheitslücken ausnahmslos schließen und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unabhängiger machen“. Die Linke lehnt den Einsatz von Staatstrojanern und Chat-Kontrollen ab. Außerdem dürfen Sicherheitslücken „nicht mehr absichtlich zu Überwachungszwecken offengehalten werden“, was nach der Forderung eines geordneten Schwachstellenmanagements klingt. Oder möglicherweise sogar nach Meldepflichten für Sicherheitslücken? So konkret wird man in dem Wahlprogramm dann doch nicht.
Desinformation oder Hass im Netz werden nicht explizit im Programm von Die Linke adressiert. Stattdessen schlägt man eine politische Lösung vor, um „Machtmissbrauch durch digitale Monopole zu verhindern“, nämlich „rechtliche Spielräume zur Zerschlagung der Monopole ausschöpfen, das Kartellrecht und seine Umsetzung stärken und personalisierte Onlinewerbung verbieten“. Als Alternative zu den „profitorientierten Plattformen der Konzerngiganten“ möchte man „öffentliche und genossenschaftliche Plattformen für gemeinnützige Dienstleistungen und wirkliche soziale Netzwerke fördern“.
Beim Datenschutz wollen die Parteien vor allem „Bürokratie abbauen“
Das Markenzeichen „Made in Germany“ als Alleinstellungsmerkmal für Produkte oder Software aus Deutschland, die besonders hohen Anforderungen an IT-Sicherheit oder Datenschutz genügen und damit einen Wettbewerbs- und Standortvorteil darstellen könnten, scheint ausgedient zu haben. Im Wahlprogramm der SPD spielt dieser Aspekt kaum noch eine Rolle. „Made in Germany“ findet sich lediglich als Überschrift für einen Steuerbonus für Unternehmen wieder, der als Investitionsprämie durch Steuererstattungen wirksam werden soll. Beziehungsweise als „Made in Germany 2.0“, wobei es hier um Zukunftstechnologien geht – allerdings nur insoweit, als diese den „Erfolgsbranchen Stahl- und Automobil-, Maschinen- und Anlagenbau, Chemie und Pharma“ zugeordnet werden können oder „bei den Halbleitern und in der Batterieproduktion“ relevant sind.
Die FDP möchte „Made in Germany“ im Bereich der Umwelttechnik etablieren, während CDU/CSU in ihrem Wahlprogramm weiterhin auf das Konzept Cybersicherheit „Made in Germany“ setzen: „Unser Ziel ist, dass Deutschland Weltmarktführer für sichere IT-Lösungen und attraktiver Standort für innovative Unternehmen der Cybersicherheit wird“.
Datenschutz befindet sich in diesem Wahlkampf auf dem absteigenden Ast. Gelegentlich wird es widersprüchlich: „Wir Freie Demokraten verteidigen die Privatsphäre im öffentlichen Raum“, heißt es im Wahlprogramm der FDP, es gebe ein Recht, sich „ohne ständige Kontrolle im öffentlichen Raum zu bewegen“ oder „ein Recht auf Verschlüsselung, damit private Kommunikation privat bleibt“. Videoüberwachung sieht man unter Umständen als sinnvoll, „an einzelnen Kriminalitätsschwerpunkten wie Bahnhöfen“, während eine „flächendeckende Überwachung im öffentlichen Raum“ abgelehnt wird. Auch wenn die FDP sich für den Schutz der Privatsphäre „in der digitalen Welt“ einsetzt, sieht sie die dringende Notwendigkeit für Bürokratieabbau im Datenschutz. Hierfür möchte sie „die Datenschutzaufsicht vereinheitlichen und so für eine einheitliche Auslegung und Anwendung des Datenschutzrechts sorgen“. Dazu solle „das Grundgesetz so geändert werden, dass Bund und Länder effektiv zusammenarbeiten und die Datenschutzkonferenz verbindliche Beschlüsse fassen kann“.
Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden. (CDU/CSU)
Der Gedanke des Bürokratieabbaus prägt auch den Umgang mit dem Datenschutz im Regierungsprogramm von Bündnis 90/Die Grünen. Die Digitalisierung der Wirtschaft möchte man mit der Anwendung von KI, robusten Cybersicherheitsstandards und der Stärkung digitaler Kompetenzen fördern – und dabei „Datenschutzbürokratie abbauen“. Jedenfalls die „ausufernde“ Bürokratie. Die Grünen stehen „für einen effektiven und zugleich praktikablen Datenschutz“. Mit der Forderung, die DSGVO „effizienter und einheitlicher“ umzusetzen, „Doppelregulierung und unklare Zuständigkeiten zu vermeiden“ oder „Zuständigkeiten für bestimmte Sektoren oder Forschung bei einzelnen Aufsichtsbehörden“ zu bündeln, reiht man sich in die Linie der FDP ein.
CDU/CSU geht beim Thema Datenschutz noch weiter: „Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden“, heißt es im Wahlprogramm. „Der Schutz der Bevölkerung und die Sicherheitsinteressen unseres Staates müssen Vorrang vor Datenschutzinteressen des Einzelnen haben. Niemand, der gegen unsere Gesetze verstößt, darf durch die Anonymität des Internets falschen Schutz erlangen.“ Passenderweise möchte man „Internetanbieter zur Speicherung der IP-Adressen und Portnummern für eine Mindestdauer“ verpflichten, den Sicherheitsbehörden „eine möglichst umfassende Befugnis zur elektronischen Gesichtserkennung“ sowie die „Nutzung moderner Software zur Analyse von großen Datenmengen, polizeilichen Datenbanken und sozialen Netzwerken“ einräumen – und das auch mit Unterstützung von KI.
Der „Pakt für den Rechtsstaat“ umfasst neben der Fußfessel auch eine Entlastung des Personals der Gerichte „mit Hilfe technischer Prozesse und durch die Unterstützung von KI“. Entsprechend sollte der Umgang mit dem Datenschutz – ob in Schulen oder gemeinnützigen Vereinen – pragmatisch erfolgen: „Die Datenschutzpolitik muss eine echte Datenchancenpolitik werden“, fordert die CDU/CSU. Statt Datenminimierung solle Datensouveränität her; die DSGVO müsse alltagstauglich werden, und „die Vertragsfreiheit auch in Bezug auf Daten muss erhalten bleiben“.
Eine starke Demokratie sorgt für Sicherheit. (SPD)
Das stellt einen klaren Kontrast zu Die Linke dar, die „[d]ie Vorstellung von Daten als verkäuflichem Eigentum“ ablehnt. Allerdings kommt man an einer Stelle den Forderungen der FDP und Bündnis 90/Die Grünen nahe: nämlich dann, wenn es darum geht, „die bestehenden Doppelstrukturen zum Datenschutz auf Bundes- und Landesebene“ abzubauen.
Wirklich interessant dürfte es allerdings sein, wer im Falle der schwarz-gelben Wunschkoalition von Christian Lindner auf seinen Teil der Forderungen bezüglich des. Schutzes der Privatsphäre, der Bürgerrechte und Freiheiten im Netz oder der Vertraulichkeit der (individuellen) Kommunikation, wie das Recht auf Verschlüsselung, verzichten wird.
Wenn im Wahlprogramm der SPD vom Grundrecht der Freiheit die Rede ist, dann bezieht sich dies auf die „Freiheit von Angst“, die im Kontext der inneren Sicherheit und des Schutzes „aller Bürgerinnen und Bürger vor Kriminalität, Gewalt und Hetze“ verstanden wird: „Eine starke Demokratie sorgt für Sicherheit.“ Folgerichtig spielt der Datenschutz, der im Kern nicht den Schutz der Daten, sondern der informationellen Selbstbestimmung und der Grundrechte meint und eng mit dem Schutz der Privatheit sowie der Freiheit in elektronischen Netzwerken verbunden ist, für die frühere „Datenschutz-Partei“ nur noch eine nachgeordnete Rolle.
Datenschutz findet sich bei der SPD nur noch dort, wo es um die Stärkung der „Kompetenzen der Sicherheitsbehörden gegen Cybercrime“ oder „bessere Strafverfolgung“ geht. „Dabei gewährleisten wir den Schutz der Daten der Nutzerinnen und Nutzer, stärken die IT-Sicherheitsmaßnahmen der Unternehmen und ihre Verantwortung im Kampf gegen Hass und Hetze im Netz“, „selbstverständlich unter strikter Wahrung der Grundrechte und des Datenschutzes“.
Wer Freiheit für Sicherheit opfert, verliert beides
Auf die Nachfrage von Journalistinnen und Journalisten, die am besagten Sonntagmorgen dem Auftakt der SPD-Kampagne beiwohnten, wie die „Sicherheit“ in den Wahlkampf-Motiven der SPD zu verstehen sei, bat Matthias Miersch erst einmal um Geduld, bis die zweite Welle an Motiven präsentiert werde – mit Verweis auf den QR-Code auf den Plakaten. Darüber könnten Aktualisierungen abgerufen werden. Für die Sozialdemokraten, erklärte er, sei Sicherheit weit gefasst und umfasse neben der inneren und äußeren Sicherheit auch die soziale Sicherheit.
Hinter der Wahl ausgerechnet dieser Nomenklatur in den Motiven dürfte dennoch der Bundeskanzler selbst vermutet werden: „Ohne Sicherheit kann es keine Freiheit und keinen Wohlstand geben“, sagte Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Dieses Sicherheitsverständnis prägte die Politik der Ampel-Koalition und begleitete den Beschluss des Sicherheitspakets – ungeachtet der mahnenden Worte des US-Verfassungsvaters Benjamin Franklin, der einst warnte, dass diejenigen, die Freiheit für Sicherheit opfern, am Ende beides – Freiheit und Sicherheit – verlieren werden.
Inzwischen sind nicht nur Personal Computer, sondern auch 1984 ziemlich überholt. Zwar hat heute fast jede und jeder, der oder die es sich leisten kann, Zugang zu Informationen und kann seine Meinung frei kundtun – dies sogar relativ kostengünstig. Doch alle Geräte, die die Nachfolge der PCs angetreten haben, enthalten Hardware und Software, die praktisch unbegrenzte Überwachung, Beobachtung und Verfolgung ermöglichen würden. Wenn man es denn wollte. Was man in einer Demokratie natürlich nicht will.
Es sei denn – wie wir spätestens seit der NSA-Affäre und den Snowden-Enthüllungen wissen – die Umstände machen es erforderlich. Dann muss man. Und irgendwie scheinen diese Umstände, angefangen bei Versprechen personalisierter Werbung über Kriminalitätsbekämpfung und Jugendschutz bis hin zur Pandemie, immer häufiger Anlass zu bieten, die Freiheit, die Apple uns 1984 in ihrem Werbespot noch versprochen hat, der Sicherheit und Überwachung zu opfern.
Werde Mitglied von 1E9!
Hier geht’s um Technologien und Ideen, mit denen wir die Welt besser machen können. Du unterstützt konstruktiven Journalismus statt Streit und Probleme! Als 1E9-Mitglied bekommst du frühen Zugriff auf unsere Inhalte, exklusive Newsletter, Workshops und Events. Vor allem aber wirst du Teil einer Community von Zukunftsoptimisten, die viel voneinander lernen.
Jetzt Mitglied werden!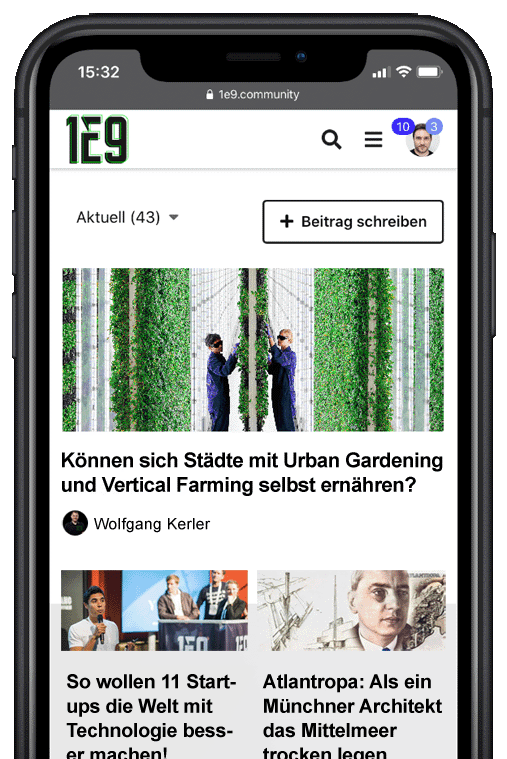
Spannend ist vor allem, was nicht in den Wahlprogrammen steht
Insgesamt ist das, was in den Wahlprogrammen fehlt, fast interessanter als das, was tatsächlich darinsteht. So bleibt das Recht auf Verschlüsselung, das einst als Garant für anonyme und vertrauliche Kommunikation im Netz galt, bis auf wenige Ausnahmen unerwähnt. Datenschutz wirkt wie eine lästige Pflicht, die der „wirklich effektiven Kriminalitätsbekämpfung“, der digitalen Verwaltung, dem gemeinnützigen Engagement oder Investitionen im Weg steht. Die Gefahr der Social-Scoring-Systeme, die, wie Harari im Nexus schrieb, in einem Land wie den USA gar nicht denkbar seien, scheint in Deutschland offenbar überwunden und verdient keine Erwähnung mehr. Und die Entkriminalisierung der IT-Sicherheitsforschung? Nachdem deren Umsetzung durch die Ampel scheiterte, hat man sie vollständig aus den meisten Wahlprogrammen gestrichen.
Das Ziel von Macht ist Macht. (1984)
Das, was in den Wahl- und Regierungsprogrammen nicht (mehr) steht, ist nicht etwa Dilettantismus bestimmten Wählergruppen gegenüber, sondern ein Signal an andere Parteien, wie flexibel man im Fall verschiedener politischer Koalitionen sein will – und wie wenig man sich von den eigenen Werten bei Einschränkungen der Freiheit und der Grundrechte im Zweifel einschränken lassen möchte. „Macht ist kein Mittel, sie ist ein Endzweck“, sagte der zwielichtige Protagonist in George Orwells 1984, O’Brien. „Das Ziel von Macht ist Macht.“
Über Jahre hinweg prägte dieser Roman die westliche Welt in ihrer Vorstellung von Stalinismus und Kommunismus. Es war jedoch eine Vision, mit der der Futurologe und Science-Fiction-Autor Stanislaw Lem, der das stalinistische System aus der Autopsie kannte, ganz und gar nicht einverstanden war. In einem Brief an seinen amerikanischen Übersetzer Michael Kandel bezeichnete er die Dystopie in 1984 gar als „falsche Rationalisierung“. Die Realität war laut Lem wesentlich schlimmer und keineswegs exzellent strukturiert, geordnet und durchdacht, wie es den Lesenden in 1984 dargeboten wurde.
Der Platz für ein reales Vorbild für 1984 bleibt also bis auf Weiteres frei. Möglicherweise ist es der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, was man dagegen tun könnte, damit es irgendwann, rein hypothetisch, nicht zu einem 1984 „Made in Germany“ kommt. „Krieg ist Frieden; Freiheit ist Sklaverei; Unwissenheit ist Stärke.“ Und 1984 ist eine Dystopie – keine Handlungsanweisung. Noch sind die für diese Kolumne untersuchten Wahlprogramme nicht auf Big Brother-Kurs, aber eine Tendenz zeichnet sich ab: Ein Staat, der Sicherheit vor inneren und äußeren Bedrohungen, aber auch vor Hetze und Desinformation verspricht, muss dafür offenbar Freiheit opfern. Von Wahl zu Wahl ein bisschen mehr?
Dr. Aleksandra Sowa gründete und leitete zusammen mit dem deutschen Kryptologen Hans Dobbertin das Horst Görtz Institut für Sicherheit in der Informationstechnik. Sie ist zertifizierter Datenschutzauditor und IT-Compliance-Manager. Aleksandra ist Autorin diverser Bücher und Fachpublikationen. Sie war Mitglied des legendären Virtuellen Ortsvereins (VOV) der SPD, ist Mitglied der Grundwertekommission und trat als Sachverständige für IT-Sicherheit im Innenausschuss des Bundestages auf. Außerdem kennt sie sich bestens mit Science Fiction aus und ist bei Twitter als @Kryptomania84 unterwegs.
Alle Ausgaben ihrer Kolumne für 1E9 findet ihr hier.
Hat dir der Artikel gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung! Werde Mitglied bei 1E9 oder folge uns bei Twitter, Facebook, Instagram oder LinkedIn und verbreite unsere Inhalte weiter. Danke!
Sprich mit Job, dem Bot!
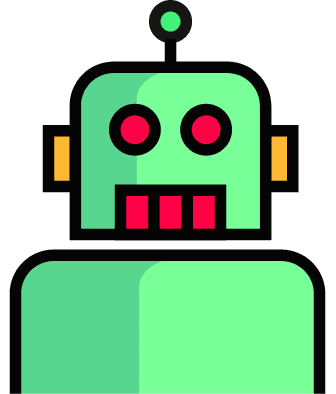
War der Artikel hilfreich für dich? Hast du noch Fragen oder Anmerkungen? Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst!

