Im Jahr 2025 soll ein Start-up aus der Schweiz im Auftrag der ESA den über 100 Kilogramm schweren Überrest einer Raketenmission aus dem Erdorbit fischen. Geschehen soll das mit einem lenkbaren Satelliten, der mit einer großen Klaue ausgestattet ist. Der Testlauf soll zeigen, ob so in Zukunft der Erdorbit von Schrott gesäubert werden kann.
Von Michael Förtsch
Der Orbit der Erde ist voller Müll. Die NASA hat derzeit mehr als eine halbe Million Objekte im Blick, die als Weltraumschrott klassifiziert werden. Darunter sind verwaiste Satelliten, abgebrochene Solarpaneele, Antennen- und Raketenteile und einiges mehr. Hinzu kommen mehrere Millionen Teile, die zu klein sind, um kontinuierlich verfolgt zu werden. Beispielsweise Metall-, Keramik- und Kunststoffsplitter, die von Hitzeschutzplatten oder aus orbitalen Kollisionen stammen. Dieser schwebende Müllhaufen wird zu einer immer größeren Gefahr und droht, zukünftige Weltraummissionen zu gefährden. Daher hat die Europäische Weltraumorganisation ESA nun einen Vertrag mit einem Start-up geschlossen, das verspricht, das Problem zumindest in Teilen lösen zu können.
Insgesamt 86 Millionen Euro lässt sich die ESA die gemeinsame Mission mit dem Schweizer Unternehmen ClearSpace kosten. Ziel ist es, erstmals ein großes Stück an Weltraumschrott im Orbit einzufangen. Das Start-up, das aus einem Projekt der Hochschule Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne hervorgegangen ist, arbeitet mit ClearSpace-1 an einem flexibel lenkbaren Satelliten, der mit einer großen Klaue ausgestattet sein soll. Mit der sollen sich größere Schrottteile anpeilen, einfangen und dann entsorgen lassen.
Bis zum Jahr 2025 soll der Müllsatellit bereit sein und von der ESA in die Erdumlaufbahn gebracht werden, um zu testen, ob er funktioniert. Als Beweis sollen die Schrottjäger einen 112 Kilogramm schweren Nutzlastadapter, der seit dem Start der Trägerrakete Vega im Jahr 2012 im Orbit vagabundiert, finden und greifen. Anschließend soll der Nutzlastadapter in eine Bahn gelenkt werden, die ihn in Richtung der Erdatmosphäre führt und letztlich zum Wiedereintritt bringt. Dabei würde er verglühen. An der Entwicklung des Greifarm-Satelliten sind nebst ClearSpace Firmen aus ganz Europa beteiligt. Darunter unter anderem Airbus Defence and Space und STT Systemtechnik aus Deutschland.
Werde jetzt Mitglied von 1E9!
Als Mitglied unterstützt Du unabhängigen, zukunftsgerichteten Tech-Journalismus, der für und mit einer Community aus Idealisten, Gründerinnen, Nerds, Wissenschaftlerinnen und Kreativen entsteht. Außerdem erhältst Du vollen Zugang zur 1E9-Community, exklusive Newsletter und kannst bei 1E9-Events dabei sein. Schon ab 2,50 Euro im Monat!
Jetzt Mitglied werden!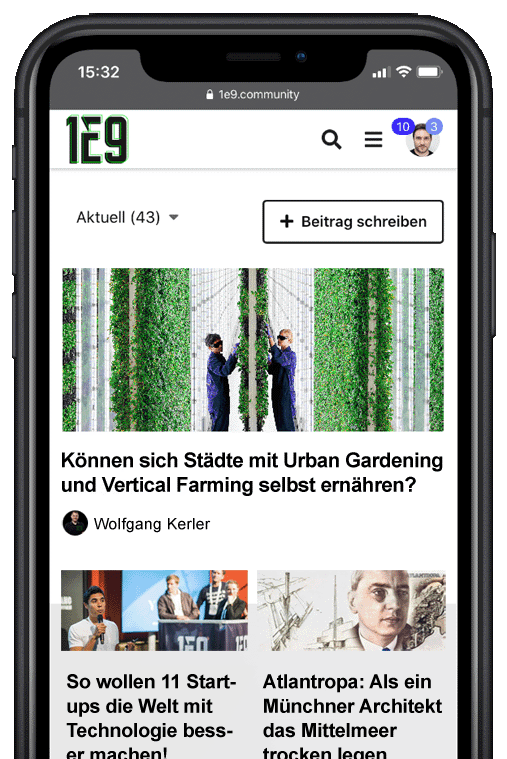
Weltraumüberwachung aus Deutschland
Laut ClearSpace sollen die Mission im Jahr 2025 und der ClearSpace-1-Satellit lediglich ein erster Schritt sein. Langfristig sollen umfassende Möglichkeiten entwickelt werden, um den Erdorbit von Müll zu befreien und den Weltraum für zukünftige Missionen wieder sicherer zu machen. „Die Frage des Weltraummülls ist drängender denn je“, sagt ClearSpace-Chef Luc Piguet. „Heute haben wir fast 2.000 aktive Satelliten im Weltraum und mehr als 3.000, die nicht mehr aktiv sind.“ In den kommenden Jahren würde sich dieses Problem mit Mega-Konstellationen wie Starlink intensivieren. Daher bräuchte es Mülllaster wie von ClearSpace, die sich um die Überreste kümmern.
Unterstützt werden sollen die Bemühungen durch Überwachungsanlagen, die den Weltraumschrott im Auge behalten – auch von europäischer Seite. Dazu gehört nach fünfjähriger Bauphase auch das erste deutsche Weltraumradar German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar – oder kurz: GESTRA – auf der Schmidtenhöhe bei Koblenz, das erst im Oktober eingeweiht worden war. Es soll Weltraumschrott in erdnahen Orbithöhen von 200 bis 2.000 Kilometern erkennen und verfolgen. Derzeit befindet es sich noch in einer Testphase. Ab Anfang 2021 soll es in den Regelbetrieb gehen.
Teaser-Bild: ClearSpace
